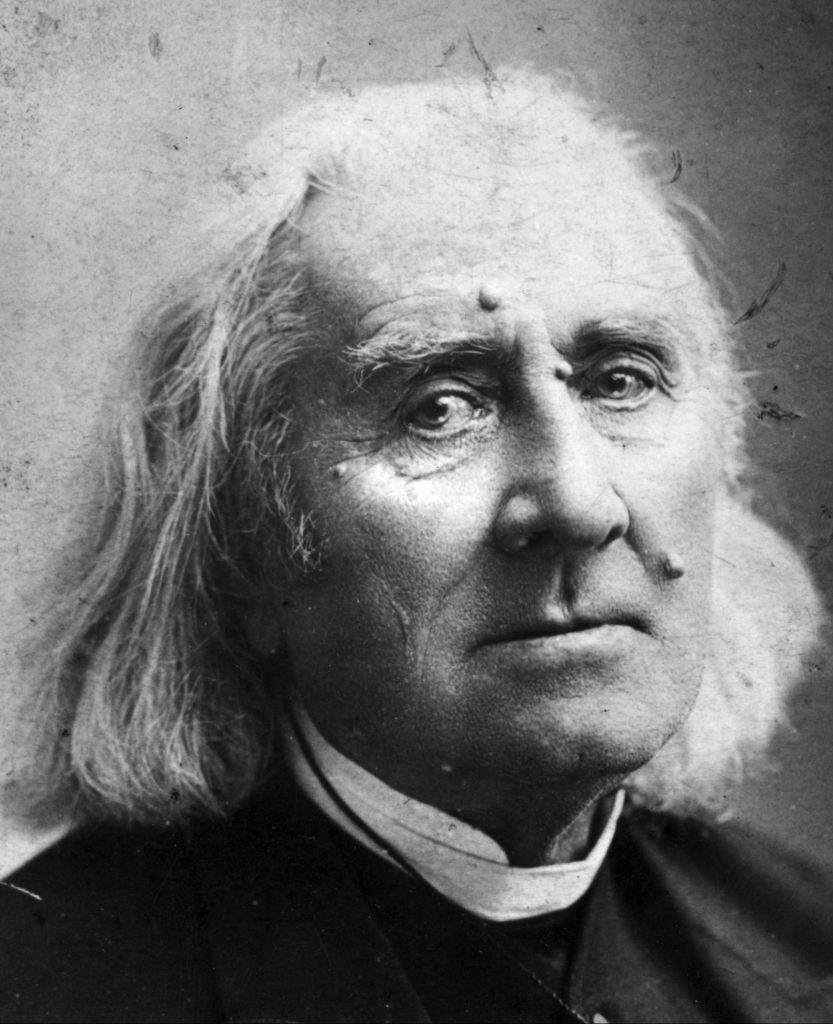Der im Februar 2002 verstorbene, für seine Bruckner-Interpretationen vielgepriesene Dirigent Günter Wand beantwortete einmal die Frage, warum er in seinem Leben so gut wie keinmal ein Werk Gustav Mahlers dirigiert habe, sinngemäß: Gustav Mahler habe in seinen Sinfonien sein intimstes Seelenleben in einer Weise offenbart, die es ihm, Günther Wand, als Musiker unmöglich mache so etwas zu dirigieren. Mit solcherlei Ansichten, möchte man denken, lag er im Fall der bombastischen, schroff durchgeformten und scheinbar ohne Melodien auskommenden Bruckner-Sinfonien goldrichtig.
Nun hat der französische Noch-Gürzenich-Orchesterchef Francois-Xavier Roth (er wird 2025 Teodor Currentzis beim Orchester des SWR ablösen) in seinem Projekt mit allen Bruckner-Sinfonien mit dem Kölner Gürzenich Orchester nach der dritten und der siebten Sinfonie Bruckners in der dritten Lieferung der Edition den Sprung ans Ende gemacht. Bruckners Neunte. Bruckner war sich wie alle anderen, welche die Neun erreichten, bewusst: diese Sinfoniezahl war besetzt. Arnold Schönbergs Worte bleiben im Gedächtnis, dass gehen muss, wer über die Neun hinaus ist. Bruckner hat sich in seiner Neunten gleichwohl heftig auch mit Beethovens Neunter auseinandergesetzt.
Bruckner lässt sich in manchem Belang mit Schubert vergleichen. Auch der hatte seine ganz besondere Art, mit den bis dahin fürs Gros der Komponierenden ehernen Gesetzen des Sonatenhauptsatzes umzugehen. Auch Schubert hatte nach Schumanns Diktum „herrliche Längen“, auch er ging mit seinem Material nicht diskursiv um, er ging in vielen Wiederholungen variativ vor, in Modulen, und auch er ließ eine seiner bedeutendsten Sinfonien nach bereits zwei Sätzen für immer liegen; seinen Landsmann Bruckner hinderte am Ende eine schwere Krankheit und schließlich 1895 der Tod daran, den drei vollendeten Sätzen seiner neunten einen Finalsatz hinzuzufügen. Der langsame Satz Adagio, er steht wie in Beethovens Neunter an dritter Stelle, war sinfonisch sein letztes Wort. Die beiden Sätze davor – das Scherzo, ähnlich unscherzhaft wie bei Beethoven und wie bei ihm an zweiter Stelle, sowie das einleitende Mysterioso – sind eine vollendete Zusammenfassung des in Bruckners Leben sinfonisch Geleisteten. In allem hörbar darüber hinaus Ausgriffe in die musikalische Zukunft, harmonisch extreme Reibungen, metrisch konträre Schichtungen, eine Architektur von einer noch nicht dagewesenen Ausdehnung in sich selbst und einer, trotz der vielen Generalpausen und Blockbildungen, geradezu fliegenbeinzählerischen Kohärenz.
Man kann das hören, wenn François-Xavier Roth Bruckner Neun dirigiert. Was ihn mit Wand verbindet: der hart erarbeitete Überblick. Wo ist etwas noch auslaufende Sequenz, wo beginnen die Metamorphosen, beginnt die Osmose eines neuen Motivs, wo endet es, wenn überhaupt? Wand wie auch Roth folgen dem zwanghaften Tüftler Bruckner bis in Einzelheiten, sie verlieren sich nicht dabei. Man meint zu hören, wie die Gewalt der Gestaltlogik des Werks ihren wehrlosen Urheber bisweilen übermannt, wie sie mit ihm durchgeht. Roths Fundus an unterschiedlichen Charakteren der bei Bruckner so wichtigen Pausen scheint unerschöpflich, ein Klangpsychologe. Das Glitzern der Klangflächen aus hohen Streichern an Stellen dessen, was von der Durchführung noch erahnbar ist, die kompakten Akkorde der Blechbläser – sie erschlagen oft alles andere – sind in Einzelklängen vernehmbar: im Klang der Hörner, der Trompeten, der Bassposaunen. Roth ist ein Meister auch der Balance, auch einer der Ökonomie dynamischer Stufung.

Hört man Bruckner aus den Händen der Mitglieder des Kölner Gürzenich Orchesters und seines Dirigenten, taucht am Ende die Frage auf: gerät dieser, besonders im abschließenden Adagio ein Leben summierende Abschied eines großen niederösterreichischen Komponisten an nicht wenigen Stellen nicht auch auf intime Weise in den von Wand verabscheuten seelischen Exhibitionismus? Roth scheut die Frage nicht. Er beantwortet sie, indem er – den abgründigen Gefühlshaushalt Bruckners einmal beiseite – die, einen alten Menschen zuverlässig begleitende Bilanzierung gelebten Lebens Klang werden lässt. Ohne Programm. Allein im Vertrauen auf die emotive Wirkung etwa jener, in den Beginn des Adagio hineinschreienden None aufwärts. Ist es ein Umweg, den der Geist macht, wenn er sich über die Sinnlichkeit Zugang zu den Dingen verschafft oder ist es der direkte Weg?
Francois-Xavier Roth und Anton Bruckner bringen ins Grübeln. Es gibt inzwischen unzählige Bruckner-Aufnahmen. In diese Neuaufnahme hineinzuhören und vergleichend zu überprüfen, ob da zum Thema Bruckner bemerkenswert Neues aufgetaucht ist – lohnt.
Anton Bruckner: Sinfonie Nr. 9 d-Moll – Gürzenich Orchester Köln / Francois-Xavier Roth (Harmonia Mundi France)