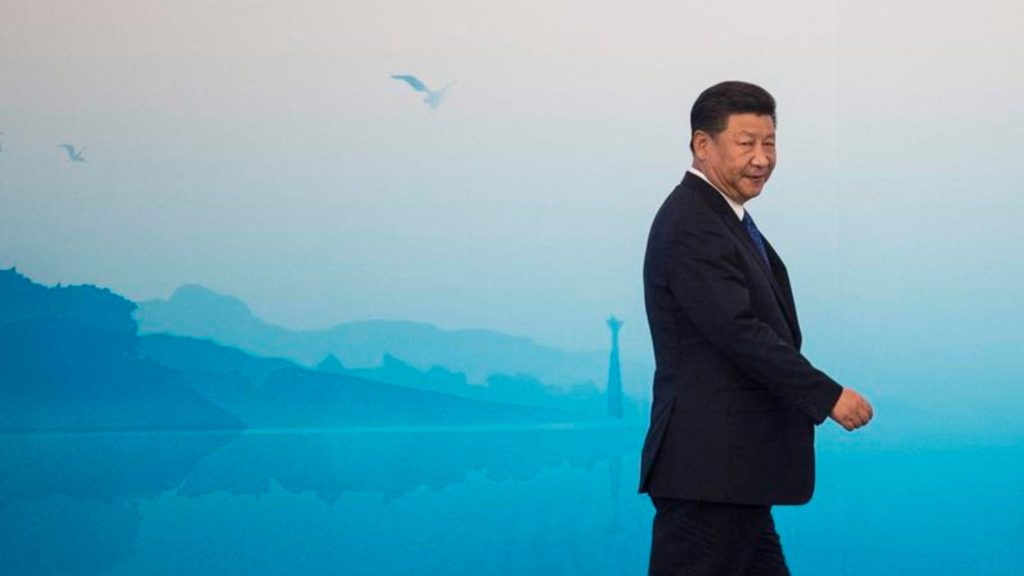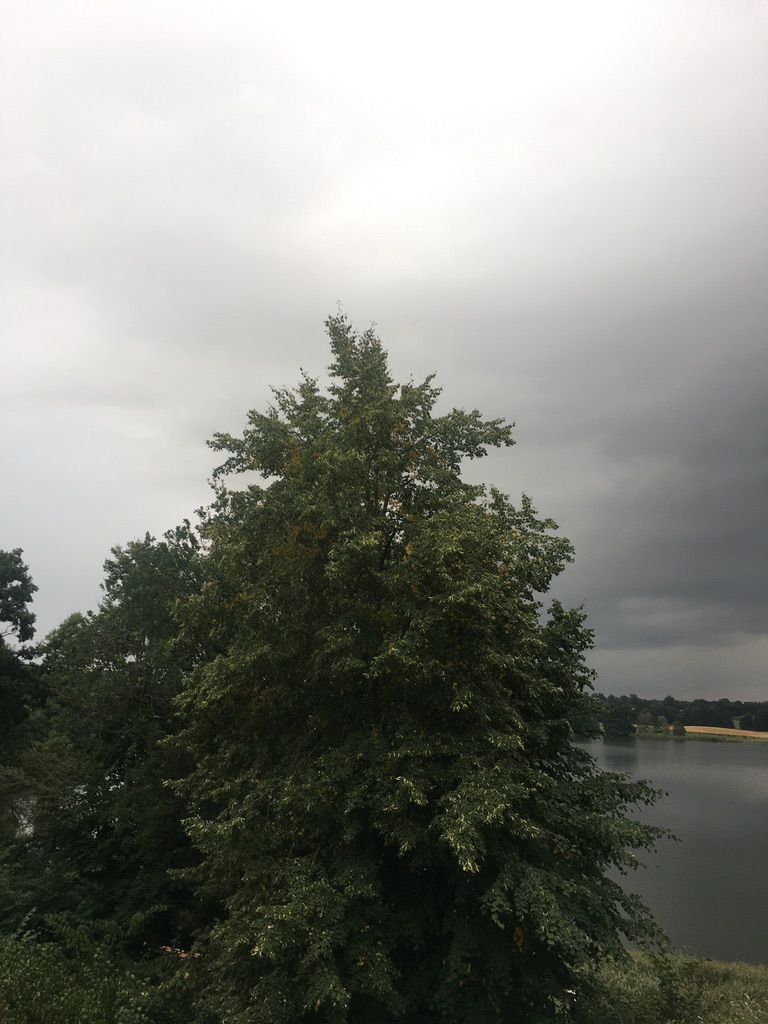Vorn drauf, so ähnlich würden sie, in Dialekt eingefärbt, in Mörfelden wahrscheinlich sagen, vorn drauf steht auf dem blauen Umschlag in weiß – in deutsch, russisch, englisch, französisch, spanisch und chinesisch – das Wort „Frieden“. Geschmückt mit der Friedenstaube des Genossen Pablo.
„Es ist November 2022“, hebt, auf den folgenden Seiten ins Russische und Ukrainische übersetzt, Rudi Hechlers Vorwort an. Wer über den Frieden redet, kann vom Krieg nicht schweigen. Also beginnt dieses Buch mit der Situation, in die uns das Geschehen in der Ukraine gebracht hat. Ein Buch über persönlich erlebte Zeitgeschichte. Und vor allem ein im denkbar schönsten alten Sinn rundum gelungenes Buch zum Lesen, ein Lesebuch. Denn Rudi Hechler hat in ihm eine, im doppelten Wortsinn: erlesene Auswahl an Lyrik, Prosa und Dokumentartexten zusammengetragen, die alle sein Leben begleitet, ausgerichtet und bereichert haben.
Schließlich ein Schauebuch. Prallvoll mit alten und brandneuen Fotos in vergilbtem Schwarzweiß bis hin zu digitalen Handyfarben; Bilder vom alten Mörfelden und seinen Menschen, am Ende Fotos von Demonstrationen gegen die aktuellen Kriege des US-Imperiums. Nicht zu vergessen die Abbildungen von Bildkunstwerken, am Beginn eine Hommage an Otto Dix, den wichtigsten proletarischen Maler gegen den Krieg. Rudi Hechler ist durch und durch ein Kulturmensch; man hat es ihm nicht an der Wiege gesungen.
Als eines von vielen Kindern einer Maurerfamilie aus dem hessischen Maurer- und Bauerndorf Mörfelden bahnte er sich seinen Weg in die Welt der Kunst, seine eigentliche Welt, auf eine für seine Klasse typische Weise: „Am 1. April 1948, einem Donnerstag, begann ich meine Schriftsetzerlehre in der damaligen Firma Bayer & Wurm, später Frankfurter Druckhaus. Ich hatte noch nie telefoniert und war noch nie allein weg aus Mörfelden.“ Da war er vierzehn, eine Generation, die in den Erinnerungen der Väter, der Großväter und Onkel seiner Familie den ersten Weltkrieg noch in den Worten derer nacherlebte, die ihn durchlitten hatten.
Als er fünf war, begann der erste große Krieg seiner eigenen Lebenszeit. Zu den eindringlichsten Stellen des Buchs gehören für den Schreiber dieser Zeilen die Passagen, in denen Rudi Hechler die Wege sachlich sprachschöner Geschichtserzählungen verlässt und unmittelbar aus seinem Leben erzählt. Im Deutschland seiner Kindheit wurde eine ganze Generation zu Fremdenhass erzogen. „Ran an den Feind!“ sangen sie in der damaligen Horst-Wessel-Schule, heute nach Albert Schweizer benannt. Der Refrain „Bomben! Bomben! Bomben auf Engeland“ – da war Rudi neun – dröhnte in Form anglo-amerikanischer Bomben krachend blutig nach Deutschland zurück. „Wir sahen wie der Himmel rot war, als Darmstadt verbrannte“, schreibt Rudi poetisch genau. „Wir hatten morgens in der Schule noch warme Bomben- oder Granatsplitter in der Hose zum Tauschen“. Im Hechler-Haus wohnte eine Mieterin mit drei Kindern, der Mann an der Front. Bei Fliegeralarm rannten Rudi und die anderen, vom Vater geweckt, die Treppe herunter, „rissen die Kinder der Mieterin aus den Betten, nahmen ihre Kleider vom Stuhl und sausten in den Keller.“

Nichts hat er vergessen. Nicht Hiroshima, nicht die Ostermärsche, nicht den großartigen Kampf der deutschen Kommunisten gegen die Wiederaufrüstung der Hitler- zur NATO-Armee. Die Geflüchteten und die Klimakatastrophe kommen zu Wort und ins Bild, der Vietnamkrieg, der Genozid der Nazis an drei Millionen sowjetischen Kriegsgefangenen. Als Rudi Hechler und die DKP-Genossen in Mörfelden im Rathausarchiv zum Thema Verfolgung jüdischer Bürger im Heimatort recherchierten, „konnte man zwar nachforschen, wieviel Hafer die Pferde Gustav-Adolfs gefressen hatten. Über das Schicksal der Juden in unserer Stadt war nichts zu finden“. Am 25. Oktober 1983 beschloss die Stadtverordnetenversammlung auf Initiative der DKP-Fraktion einstimmig die Errichtung eines Gedenksteins am Platz der ehemaligen Mörfelder Synagoge. Heute werden Menschen, die ähnlich handeln und darüber das Schicksal der Palästinenser nicht vegessen, als Antisemiten diskriminiert.
Meist geht Hechler von seinem Heimatort aus; es wird sichtbar (auch auf den vielen Fotos, auf denen Rudi und seine Frau Käthe zu sehen sind), wieviel er selbst als kommunistischer Kommunalpolitiker für diesen Heimatort geleistet hat. Auch die Feiern sind dabei, die großen Abrüstungsdemonstrationen im Bonner Hofgarten, die breiten Bündnisse, die damals zwischen den heute erfolgreich zerlegten Fraktionen der Friedenskräfte möglich waren.
Luther hielt sich 1521 in Mörfelden auf, Lenin fuhr 1917 durch – der kleine hessische Ort bleibt der Mittelpunkt des Buches, der Frieden bleibt sein roter Faden, seine Quintessenz: das Leben Rudi Hechlers. Wie ein Motto steht über diesem Leben, dem Leben einer biblisch großen „merfeller“ Kommunistenfamilie, der von Rudi angeführte Text Erich Frieds: „Solange der Untergang der Menschheit nicht hundertprozentig feststeht, lohnt es sich, dagegen zu arbeiten.“ junge Welt, late Dezember 2022