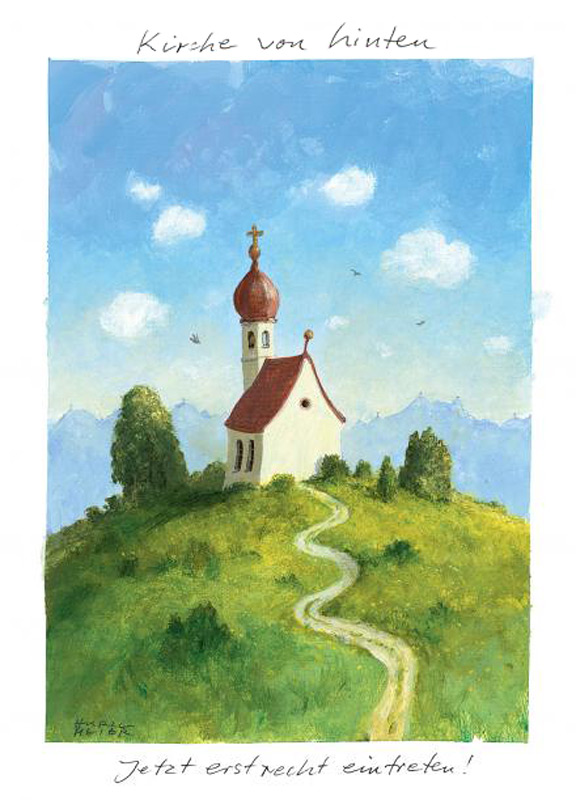Nikolaus Harnoncourt (1929-2016) im schönen Restaurantgarten in Werfen (rechts der blutjunge Autor).
Beobachtet man die Harnoncourts bei der Arbeit – ihn auf der Bühne mit einem Spitzenorchester, sie im Parkett mit den Noten auf den Knien –, merkt man ihnen nicht an, dass sie genau wissen, wo es ihnen schmeckt. Aber am Telefon auf die Frage, wo wir uns zum Essen treffen wollen, antwortet Alice Harnoncourt wie aus der Pistole geschossen: „Im Obauer in Werfen!“
Werfen liegt im Pongau, ein Filetstück alpiner Landschaft, halbe Stunde südlich von Salzburg, an der Salzach, zu Füßen des Tennengebirges. Einen richtigen Hutmacher gibt es dort, Filz und Gamsbart im Fenster, einen Handschuhmacher vier Häuser weiter. Ein österreichischer Kapellmeister, möchte man meinen, sollte entsprechend aussehen, Janker, Jagerhut und Knotenstock. Aber nichts da. Die Fotos auf seinen CD-Covers lügen nicht. Groß und gerade ist er, nicht dick, aber schwer und eher o.k. als k.u.k.
Die Augen quellen leicht hervor, wie er so in den Pongauer Abendhimmel blinzelt. Sie wirken hell und empfindlich, für Momente fast stechend, ängstliche Menschen missverstehen das oft. Der Fotografin zuliebe hat er die Sonnenbrille abgenommen. Büsche und Baumkronen dämpfen das Licht, es sprenkelt fleckige Schatten auf gebügelte Tischdecken, Gläser, unberührte Teller. Harnoncourts Hemd hat einen sportlichen Kragen, die Leinenhose ohne Gürtel. Die Gattin im türkisenen Kleid mit angesetztem Blumenmusterrock, schaut auf die Uhr: „Pünktlich, nicht wahr?“
Schon sitzen sie am Tisch rechts von der Tür. In Erwartung der Speisekarte hängt sich der Dirigent die Lesebrille um den Hals. Doch statt der Karte kommt Karl Obauer, zusammen mit seinem Bruder Rudolf Herr im kleinen, überaus feinen Haus in Werfen. „Erinnern Sie sich an unseren letzten Besuch?“, fragt der Gast, der mindestens alle zwei Jahre herkommt, das letzte Mal nach einer Bergtour mit den Enkelkindern hinauf in die Ostpreußenhütte, elfhundert Höhenmeter von unserem Tisch entfernt. „Ich bitt‘ Sie“, entrüstet sich der Wirt auf landesübliche Weise liebenswürdig. Nikolaus Harnoncourt ist eine Institution in Östereich, zusammen mit Arnold Schwarzenegger einer der wenigen Weltstars des kleinen Alpenlands – den vergisst man doch nicht!
Das Amuse-bouche lässt ahnen, wofür das Obauer berühmt ist: edelst Regionales, Kalbsmilzpaste auf getrocknetem Schwarzbrot, hausgemachte Lammwurst, Auberginen-Sardellen-Creme und Schnecken, sie erinnern Alice Harnoncourt an den Ärger im eigenen Garten. Auf die unvermeidliche Frage, ob es Mineralwasser mit oder ohne „Bitzel“ sein solle, wünscht sich der Musiker Leitungswasser. „Das Wasser in Wien“, schwärmt er, „kam bis vor kurzem aus dem Hochschwabgebirge. Obwohl sie es heute mir Grundwasser mischen, schmeckt es immer noch phantastisch. Die Leut‘ waschen ihre Autos damit – und trinken Mineralwasser.“

Nicht allein das Wasser ist Nikolaus Harnoncourt in Wien gut bekommen. In der Donaumetropole begann vor über vierzig Jahren seine Karriere, zunächst als Solocellist bei den Wiener Symphonikern. Sein Probespiel damals beobachtete der Chefdirigent persönlich, ein gewisser Herbert von Karajan. Dessen Einstellungsbegründung: „Wie der sich hinsetzt, haben Sie das gesehen – den nehmen wir.“ Unvergesslich für den Orchestermusiker Harnoncourt auch die Abende, an denen Karajans Intimfeind Furtwängler im Saal saß. „Mit Karajan ging dann etwas vor. Die Stellen, die sonst immer dunkelgrün klangen, die sollten plötzlich glutorangen leuchten.“
Die Seewolf-Lasagne, die jetzt kommt, leuchtet goldgelb, ein schimmerndes Medaillon, deutlich auf dem Teller, kein Zierat, kein Blendwerk, nur Saft und Inhalt, Minze, Basilikum, Tomaten, eine Sauce vom grünen Veltliner. Wollte man Schmaus und Hörgenuss vergleichen: So etwa klingt Harnoncourt Art, klassische Musik anzurichten. Ganz anders als weiland Herrn von Karajans musikalische Präsentierteller.
Er sitz aufrecht beim Essen. Unvorstellbar, dass er sich aufstützt am Tisch. Obwohl die dunkelrauhe Stimme nicht eben leise ist, erregt er, schwungvoll aber uneitel gestikulierend, kein Aufsehen. Er isst langsamer als seine Frau. Deren Art, sich im Schatten ihres Mannes zu bewegen, erlaubt ihr Überblick. Sie wirkt mädchenhaft, lässt kaum ein Auge von ihm, sie ist immer dabei und versieht alle Aufgaben, von der Garderobiere und Physiotherapeutin bis zur Managerin.
Alice Harnoncourt ist eine vorzügliche Geigerin. Sie arbeitet bis heute als Konzertmeisterin des Concentus Musicus, den Nikolaus Harnoncourt 1953 – „gleich nach der Hochzeit“ – mit ihr gegründet hat, um neben dem Orchesterdienst klassische Musik auf den Instrumenten der Entstehungszeit der Musik aufzuführen, damals eine Sensation.
Bis 1969 hielt er es bei den Wiener Symphonikern aus. Dann war Schluss. „Es war nach einer dieser grauenvoll spätromantischen Aufführungen der Matthäuspassion.“ Wie um den Zuckergeschmack damaliger Barockkonzerte hinunterzuspülen, nimmt er zwei Schluck frisches Quellwasser und schaut über die Gartenbäume hinauf auf Gipfelzacken im Abendlicht. „Nennen Sie es Midlife-Krise, nennen Sie es künstlerische Konsequenz – ich hatte keine Lust mehr, Abend für Abend etwas zu machen, was ich für falsch hielt.“ Er kündigte, dirigierte von Stund an. Und machte alles anders.
Es gab keine Angebote. Er war vierzig und Familienvater. Wie nebenbei hatte Alice Harnoncourt bis dahin vier Kinder zur Welt gebracht, drei Mädchen und einen Jungen. Nikolaus Harnoncourt hatte Glück. Das erste Angebot kam gleich von der Scala in Mailand, er hatte Erfolg. Etwas an ihm begeisterte die Menschen. Und der neuartige Klang der mit Darmsaiten bespannten Geigen, der ventillosen Trompeten und Hörner, der mit Leder statt mit Plastik bespannten, mit bloßen Holzschlegeln traktierten Pauken des Concentus passte ins kulturelle Klima der 1968er Jahre, er provozierte einen neuen Klassikstil. Der Muff von 200 Jahren Bach- und Mozartinterpretationen war wie weggeblasen.
Als ich ihm von Mozarts Lieblingsessen, dem gebackenen Kapaun erzähle, neigt er sich etwas tiefer über die Brennnessel-Graukäseknödel-Suppe, die wir inzwischen essen. Woher ich das habe? Harnoncourt wühlt gewohnheitsmäßig in alten Autographen, Briefen, Dokumenten, bevor er die erste Note eines für ihn neuen Werks dirigiert. „Man weiß nie, ob etwas stimmt“, sagt er, und seine Rechte fegt Brotbrösel vom Tisch. „Ich kenne das aus meiner Familie. Da soll ich mit sieben Jahren einmal gesagt haben, ich mag Früchtebrot. Alle glaubten es. Meine Mutter – sie ist sechsundneunzig – hat mir bis vor vier Jahren jedes Jahr im Dezember zum Geburtstag Früchtebrot geschickt. Ich mag gar kein Früchtebrot. Aber sie ist überzeugt, es ist meine absolute Lieblingsspeise.“
Mütterlicherseits stammt er in direkter Linie von den Habsburgern ab. Der Ururgroßvater war Erzherzog Johann, der eine Postmeisterstochter heiratete und damit seiner Nachkommenschaft den Erzherzogtitel verscherzte. Der Großvater besaß eine große Jagd in der Steiermark. Der Enkel wohnt heute in St. Georgen bei Graz, wo er schon seine Jugend verbracht hat. Ab und zu besucht er die Familie in einem großen Schloss. „Ich sitze dort immer wieder gern an der Tafel. Die absolute Kennerschaft dieser Gesellschaftsschicht hat mich schon als Kind beeindruckt. Dort gab es Auerhahn, so ziemlich das Beste, was ich je gegessen habe. Es gibt überhaupt nur zwei, drei Leute in Österreich, die das wirklich gut zubereiten können.“

Das Rehrückenfilet mit Gebirgswermut-Sauce, Vogelbeeren und Selleriepüree, das die Kellnerin jetzt behutsam vor den Dirigenten hinstellt („Bitte sagen Sie nicht Maestro“), ist meisterlich zubereitet. Die kräftigen Hände, die sonst – übrigens ohne Stöckchen – Beethoven und Schuberts Takte zerteilen, widmen sich nun ebenso präzis drei zarten Scheiben Wild. Ein Glas Rotwein dazu? Sehr recht, einen weichen, typisch österreichischen Blaufränkisch vom Neusiedlersee. Aber nur eines. Frau Harnoncourt bietet an, die zwei Stunden Rückweg n die Steiermark zu fahren. Nicht nötig. Es wird bei einem Glas Roten bleiben.
Das Aristokratische hat Nikolaus Harnoncourt abgetan wie die Gürtel in seiner Hose. Schon sein Vater tanzte aus der Reihe. Dessen Stammbaum ging auf die Harnoncourts im einstigen Dreiländereck Belgien-Frankreich-Lothringen zurück. Die Familie kam, als Franz von Lothringen Kaiserin Maria Theresia heiratete, im 18. Jahrhundert in die Steiermark. „Sie können den Namen übrigens aussprechen, wie Sie wollen: mit oder ohne H am Anfang, ich sprech‘ ihn ja selbst nie aus.“ Warum nicht? „Ich geh‘ nicht ans Telefon.“
Harnoncourts Vater wünschte sich glühend, Musiker zu werden – unmöglich für einen Adeligen jener Zeit. Er wählte den Beruf, der, wie er meinte, am meisten mit Musik zu tun hatte: Er ging zur Marine. „Der Franz Lehár war ja auch bei der Marine. Auf jedem größeren Schiff gab’s ein Orchester, jedenfalls in Österreich.“ Leider begann, kaum dass der Vater sich solch einer Bordkapelle bemächtigt hatte, der erste Weltkrieg. Da schwieg die Musik. „Und als es vorüber war, war das Wasser weg.“ Soll heißen: Österreich hatte alle Zugänge zum Mittelmeer verloren.
„Nach dem Krieg war die Familie dann so verarmt“, erzählt er und Witz blitzt in den hellen Augen, „dass dem Großvater 1924 eine Bedienstete ohne sein Wissen das Frühstücks-Gulasch bezahlte. Er war nämlich der Ansicht, dass er ohne Frühstücks-Gulasch nicht leben konnte.“ Sein Enkel wird jetzt den Schwarzbeernocken gerecht, unser Dessert, in der Pfanne gebacken, eine Pongauer Spezialität. „Ist denn noch Schwarzbeerzeit?“, fragt der Dirigent die Kellnerin. „Nicht mehr lang.“
Vor einiger Zeit bekam er einen Brief aus Rom, mit auserlesen geschmackvollem Briefkopf, von einem „Taster of Wine“. Der Römer wollte wissen, ob seine, des Römers, Methode zur Beurteilung der Entwicklung von Weinen analog auf die Entwicklung klassischer Musik anwendbar sei. Harnoncourts Methode, Mozart, Beethoven oder Schumann auszubauen, hatte es ihm offenbar angetan. Auf eine vorsichtige Antwort aus St. Georgen kam aus Rom eine hölzerne Kiste mit zwei Flaschen Wein, zwei Gläsern und einem Brief. „Er gab mir genaue Anweisungen, was ich nach jedem Schluck beachten sollte. Fünf Stunden vor der Verkostung dürfe ich nichts mehr essen. Ich solle den Wein beim Verkosten unbedingt auf einen Glastisch stellen, mit einem Licht darunter.“
„Und: haben Sie’s gemacht?“ Harnoncourt schmunzelt, er nippt vorsichtig am Blaufränkisch: „Offengestanden – ich trau‘ mich nicht.“ Essen und Trinken, 5/97